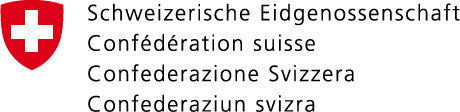UNO-Sicherheitsrat: Nutzung des Potenzials der Wissenschaft für Frieden und Sicherheit
Die Schweiz hat am 17. Mai 2024 ein Treffen des UNO-Sicherheitsrats organisiert, um das Zusammenspiel zwischen der Wissenschaft und dem Rat zu stärken. Der Einbezug der Wissenschaft in die Entscheidfindung des Rats hat das Potenzial, gegenseitiges Vertrauen zu fördern und einen Beitrag zu leisten für die Prävention von Konflikten sowie für nachhaltigen Frieden und einen effizienten Sicherheitsrat – beides Prioritäten des Bundesrats für die Schweizer Ratsmitgliedschaft 2023-2024.
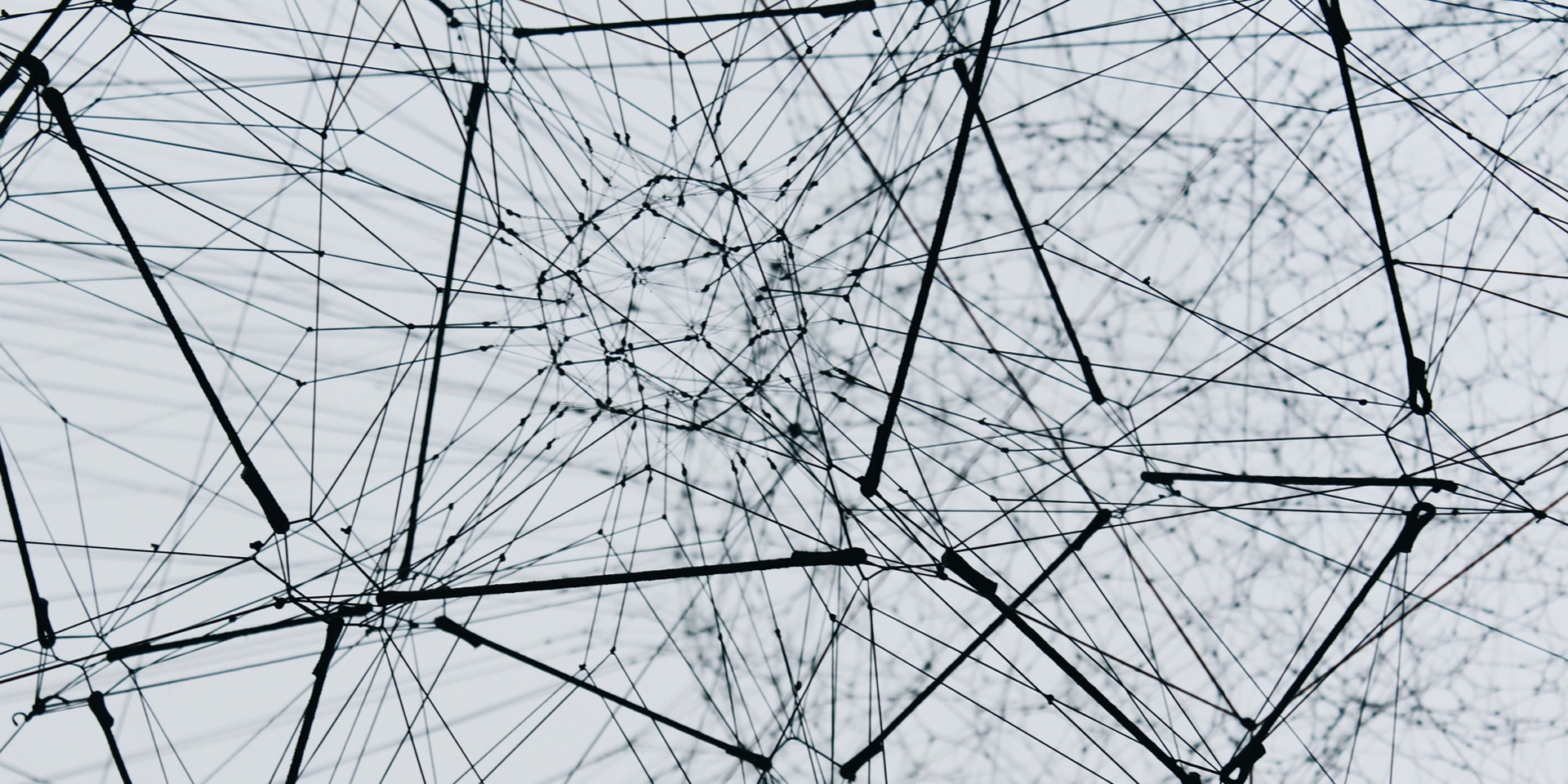
Das wissenschaftliche Sammeln, Vernetzen, und Analysieren von Daten kann den UNO-Sicherheitsrat dabei unterstützen sein Mandat für Frieden und Sicherheit besser wahrzunehmen. © Alina Grubnyak / Unsplash
Die Zahl der Konflikte weltweit hat heute einen Höchststand seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht. «Es ist an der Zeit, unsere Instrumente zu optimieren, um Vertrauen wiederherzustellen und dauerhaften Frieden zu sichern», erklärte Bundesrat Ignazio Cassis bereits am 3. Mai 2023 in einer offenen Debatte des UNO-Sicherheitsrats unter Schweizer Präsidentschaft.
Ein Pfeiler für die Wiederherstellung von gegenseitigem Vertrauen ist der Einbezug der Wissenschaft in die Friedensförderung und die internationale Diplomatie. Denn evidenzbasiertes, gemeinsam genutztes Wissen kann das Vertrauen zwischen Staaten fördern und die Entscheidungsfindung in internationalen Gremien unterstützen. Deswegen hat die Schweiz am 17. Mai 2024 im UNO-Sicherheitsrat ein informellesTreffen organisiert, das die Nutzung der Wissenschaft für die Arbeit des Sicherheitsrats in den Vordergrund stellt. Vor dem Hintergrund der engen Verknüpfung der globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Pandemien, Wirtschaftskrisen und Konflikten, hat die Wissenschaft das Potenzial, die Entscheidfindung des UNO-Sicherheitsrats zu unterstützen und zur Erfüllung seines Mandats für Frieden und Sicherheit auf der Welt beizutragen.
Der Rat wurde heute von Henrietta Fore, Vorstandsmitglied bei der Stiftung Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) und Dr. Sascha Langenbach, Data Scientist am Center for Security Studies der ETH Zürich, gebrieft. Im Interview erzählen sie wie Wissenschaft konkret den Sicherheitsrat dabei unterstützen kann sein Mandat besser zu erfüllen.

Wie können wir wissenschaftliche Antizipationslösungen nutzen, um globale und vernetzte Herausforderungen zu lösen?
Henrietta Fore (GESDA): Die Quantentechnologie birgt ein grosses Potenzial für die Lösung globaler Probleme. Die Antizipation des Aufkommens dieser Technologie ist eine unserer Prioritäten. GESDA hat zusammen mit dem CERN und der UBS als Hauptpartner das Open Quantum Institute (OQI) ins Leben gerufen, das diese Technologie nutzen wird, um die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO zu erreichen. Dank der von den Algorithmen des Quantencomputers abgeleiteten Lösungen planen Forscher, Grossunternehmen, Start-ups und internationale Organisationen Anwendungen in den Bereichen Gesundheit, Wasseraufbereitung, Dekarbonisierung sowie Anwendungen für die Produktion von mehr Nahrungsmitteln vor Ort, die Nutzung von weniger Land und die Berücksichtigung von Umweltparametern.
Welches Umdenken braucht der Sicherheitsrat, damit dieser sein Mandat auf Basis von evidenzbasiertem Wissen besser umsetzen kann?
Sascha Langenbach (ETH): Mit dem Begriff «Umdenken» geben Sie mir ein wichtiges Stichwort. Ich denke hier vor allem an die Notwendigkeit eines längerfristigen organisationellen Wandels innerhalb der Vereinten Nationen. Im heutigen Briefing des Sicherheitsrates ging es vor allem um die Frage, wie UNO-Organe besser mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus externen Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten können. Diese Art Kooperation ist wichtig. Wir sollten aber nicht vergessen, dass die UNO auch innerhalb der eigenen Organisation ganz erheblich auf wissenschaftlich-technische Expertise und Ressourcen angewiesen sind. Beides gilt es in Zukunft weiter auszubauen.
Vor allem bei Fragen der Datenverarbeitung und -analyse müssen UNO-Organe ihre eigenen, internen Ressourcen und Kompetenzen stärken. Die Notwendigkeit hierzu zeigt sich beispielhaft in den vom UNO-Sicherheitsrat mandatieren Friedensmissionen. Die in Krisen- und Konfliktgebieten tätigen UNO-Friedenstruppen müssen jeden Tag eine Vielzahl an Informationen zusammenführen und auswerten. Nur so lässt sich ein zutreffendes Lagebild erstellen und die Zivilbevölkerung vor gewaltsamen Übergriffen schützen. Die Zahl der relevanten Informationsquellen wächst dabei stetig. UNO-Friedenstruppen müssen interne Berichte und Patrouillendaten genauso auswerten, wie Posts auf Social-Media-Plattformen und grosse Sammlungen von Satellitenbildern, die mit wachsender räumlich-zeitlicher Auflösung verfügbar sind. Bei der Sichtung und Auswertung dieser Daten können moderne Methoden der Informationsverarbeitung den UNO-Friedenstruppen helfen. Dafür wird aber auch eine entsprechende technische Infrastruktur benötigt, sowie Personal mit guter Vorbildung in den Bereichen «Data Science» und «Data Engineering». Ganz allgemein ist auch ein Wandel der Arbeitskultur innerhalb der UNO wünschenswert, um evidenzbasiertes Wissen noch stärker als bisher in Entscheidungsprozesse mit einzubinden.
Henrietta Fore (GESDA): Angesichts der zunehmenden Vernetzung von globalen Herausforderungen und des raschen technologischen Fortschritts hat die Wissenschaft das Potenzial, die Entscheidfindung des UNO-Sicherheitsrats zu verbessern und ihm zu helfen, sein Mandat besser zu erfüllen. Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewusst und arbeitet bereits auf vielfältige Weise mit wissenschaftlichen Experten zusammen.
Die Antizipation dieser Trends schafft den Raum für präventive Massnahmen und Beratung. Der GESDA Science Breakthrough Radar® zielt genau auf diese Herausforderung ab: Er stützt sich auf die Ansichten von rund 2000 führenden Wissenschaftlern aus 73 Ländern auf allen Kontinenten und bietet einen kuratierten und objektiven Überblick über die wichtigsten wissenschaftlichen Trends der kommenden 5-10-25 Jahre. Der Radar hilft uns, die Zukunft zu nutzen, um die Gegenwart zu gestalten!
Auf welche bestehenden Projekte der ETH und von GESDA kann der Sicherheitsrat zurückgreifen, um sein Potenzial für den Einsatz der Wissenschaft zur Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit weiter auszubauen?
Henrietta Fore (GESDA): Das von mir bereits erwähnte OQI ist ein solches konkretes Projekt. Ein anderes ist eine Zusammenarbeit zwischen GESDA, dem Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP) und der School of International and Public Affairs (SIPA) der Columbia University. Wir haben Experten auf dem Gebiet von Krieg und Frieden zusammengebracht, um eine Methode zu entwickeln, mit der sich vorhersagen lässt, wie Fortschritte in Wissenschaft und Technologie die Sicherheit und die Machtverteilung in den nächsten 10 bis 25 Jahren beeinflussen werden. Diese Methodik soll dazu dienen, hochrangige politische Entscheidungsträger über die Art künftiger Konflikte und die Instrumente für deren Lösung zu informieren.

Sascha Langenbach (ETH): Die Expertise von Forscherinnen und Forschern der ETH Zürich ist für die UNO in vielerlei Hinsicht relevant. Daher haben beide Organisationen im Oktober 2023 auch ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, das darauf abzielt, wissenschafts- und technologiebasierte Kooperationen zwischen der UNO und der ETH zu fördern.
Unser Institut, das Center for Security Studies (CSS), arbeitet gegenwärtig mit zwei verschiedenen UNO-Partnern zusammen. Zum einen beraten wir das UNO-Krisenzentrum bei der Sammlung und Analyse von Ereignisdaten in Konfliktgebieten. Hierbei kooperieren wir ETH-seitig eng mit Kolleginnen und Kollegen des Informatikdepartementes, insbesondere mit dessen «IVIA Lab». Gemeinsam gibt unser inter-disziplinäres Team dem UNO-Krisenzentrum Empfehlungen dazu, wie computergestützte Verfahren genutzt werden können, um die Datensammlung von UNO-Friedenstruppen in Konfliktgebieten zu vereinfachen, widersprüchliche Informationen schneller zu erkennen, und eine konsistente Datensammlung über verschiedene Friedensmissionen hinweg zu ermöglichen. Unser Team hilft dem UNO-Krisenzentrum ausserdem dabei, die Möglichkeiten auszuloten, die neue Verfahren des maschinellen Lernens bei der Vorhersage von Konfliktdynamiken in Krisengebieten bieten.
Zum anderen betreut unser Center ein Ausbildungsprogramm im Bereich Konfliktmediation, das von der UNO-Hauptabteilung für politische Angelegenheiten unterstützt wird. Dieses Ausbildungsprogramm ist in den vergangenen Jahren bereits von mehreren Mitarbeitenden der UNO durchlaufen worden.
Natürlich gibt es viele weitere Arbeitsbereiche, in denen die Expertise von WissenschafterInnen der ETH Zürich für die UNO von Wert sein kann. Hierzu zählen etwa die Themen der Klimamodellierung, der KI-gestützten Auswertung grosser Mengen an Satellitendaten, sowie Forschung zur automatischen Erkennung von Desinformation in den sozialen Medien. Die im Herbst 2023 begründete Partnerschaft zwischen UNO und ETH soll diese Art Expetise in Zukunft einfacher zugänglich machen.
Wissenschaft als Bindeglied für das Stärken von gegenseitigem Vertrauen für den Frieden
Ein starker Multilateralismus kann auch in diesen turbulenten geopolitischen Zeiten einen Mehrwert bieten. Die Stärkung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Staaten für das Fördern eines nachhaltigen Friedens – eine Priorität des Bundesrats für die Schweizer Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat 2023-2024 – ist zentral in einer Zeit, in der das multilaterale System unter Spannung steht. Ein gemeinsam respektierter normativer Rahmen stärkt die Vorhersehbarkeit, die im Gegensatz zur Willkür gegenseitiges Vertrauen sichert. Hier spielt die Wissenschaft eine wichtige Rolle: «Die Wissenschaft und neue Technologien bieten uns die Möglichkeit, die Risiken von heute und die Chancen von morgen besser zu antizipieren und zu verstehen», sagte Bundesrat Cassis am 3. Mai 2023 vor dem Sicherheitsrat in New York. Es gilt, dieses Wissen auch für die Prävention von Konflikten und die Sicherung von Frieden einzusetzen.
Wissenschaftsdiplomatie ist ein wichtiges Instrument der Schweizer Aussenpolitik
Gemäss der Aussenpolitischen Strategie 2024-2027 des Bundesrats kann die Wissenschaft einen wichtigen Beitrag zu den diplomatischen Bemühungen im Kontext der Guten Dienste, der Friedensförderung und der globalen Gouvernanz leisten und so zu evidenzbasiertem aussenpolitischem Handeln beitragen. Die Spitzenposition der Schweiz in internationalen Rankings in den Bereichen Bildung, Forschung und Innovation schafft gute Voraussetzungen für eine profilierte Wissenschaftsdiplomatie der Schweiz. Diese trägt auch dazu bei, das internationale Profil und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Akteure im Bereich Bildung, Forschung und Innovation zu stärken und Kooperationsprojekte auf der ganzen Welt zu unterstützen.